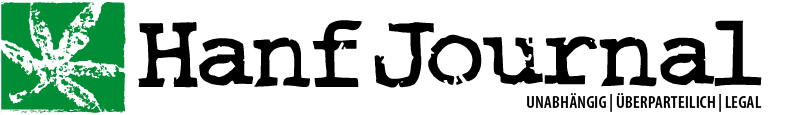Das Land in dem Gras und Rastas hausen
(Pub. Juni 2004)
Jemand
hatte behauptet, dass die Leute auf der karibischen Insel St. Vincent
unbehelligt auf der Straße kiffen können und dass das
hervorragende St.-Vincent-Grass auf großen Feldern wie Tomaten
angebaut würde. Insel der Seligen? Ich wollte nach diesen
Erzählungen jedenfalls genau dorthin. Von Tobago aus, wo man
trotz strengster Prohibition wie üblich mit etwas Glück
alles bekommt (eine Tüte zu circa einem Euro), war ich in einer
Propellermaschine zu der Vulkaninsel geflogen. Nun saß ich in
der Mittagshitze, mit Rucksack und meiner afrikanischen Trommel
behängt, vor dem Flughafen und wartete auf meinen Kontaktmann.
Plötzlich hörte ich jemanden meinen Namen rufen. Ein
schwarzer Al-Capone-Typ mit Schnurrbärtchen und schlitzohrigem
Lächeln winkte mir aus einem Lastwagen heraus zu. Er hieß
Dexter .Wir rumpelten durch die Hauptstadt Kingstown in die grünen
Berge hinein. Endlich bogen wir in ein Dorf ein und hielten vor einem
orangenen Bungalow mit Veranda. „Hier ist dein Haus“, sagte er
stolz, nahm meinen Rucksack und schloss die Tür auf. „Wie
gefällt`s Dir?“ Dexter hatte offenbar noch schnell das Innere
meergrün gestrichen, war aber noch nicht ganz fertig. Farbeimer
und Utensilien standen herum. Mein Schlafzimmer, mit einem riesigen
komfortablen Bett möbliert, gefiel mir auf Anhieb. Kurze Zeit
später saß ich im Kreis neugieriger Nachbarn, Rastas,
Kinder, Mütter, im Schatten neben dem Bungalow. Ein junger Mann
fragte mich ernst nach Adolf Hitler und betonte: „Er wird nie aus
dem Höllenfeuer erlöst werden!“ Mehrere Joints wurden
gedreht, und als ich meinen weiterreichen wollte, wurde ich sanft
belehrt: „Wir wissen, dass man das woanders so macht, aber hier auf
St.Vincent bekommt jeder, der möchte, seinen eigenen Spliff.“
Ich betrachtete mir das lange, knubbelige Gebilde in meiner Hand mit
der fein duftenden Rauchfahne und fühlte mich angekommen und
sehr glücklich. Es war wie in einer Familie. Ein deutliches
Gefühl beschlich mich, dass die eine Woche, die ich hier
verbringen wollte, zu kurz sein würde. Abends unter dem
tropischen Sternenhimmel schlenderte ich barfuss zur kleinen Kneipe
hinüber. Proppenvoll! Bierflaschen wurden aus dem Fenster
hinausgereicht, der Rum floss. Eine rundliche Frau tanzte und schwang
die Hüften zur Musik. Der Wirt, ein drahtiger kleiner Rasta mit
Wollmütze, drehte gerade einen mächtigen Spliff: „Lady,
take a pull . . .“ Schon hielt ich den Riesenjoint in der Hand und
bekam von mehreren Seiten Feuer gereicht. Ich bedankte mich höflich.
„Sag mir, was es kostet! Morgen will ich mir dann eigenes Ganja
besorgen . . .“ So weit kam es dann die weiteren acht Tage lang
jedoch nicht. Alles war im Überfluss vorhanden.
Am
anderen Morgen stand eine nachtblaue Limousine vor dem Haus.