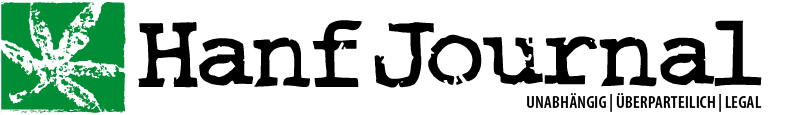(spanisch: „Ich schufte wie ein Esel“)
An einem lauen Mainachmittag liege ich im Parque Maria Lisa in Sevilla, im kühlen Schatten eines riesigen Gummibaums. Die Tasche als Kopfkissen, die Jacke als Decke, 28 Grad Celsius als Entspannungsfaktor, Maria als Gesprächspartnerin. „Currar“, was im andalusischen Dialekt soviel bedeutet wie „arbeiten“ oder „schuften“, könnte doch vom lateinamerikanischen „Curare“ kommen, sinniere ich so dahin. Curare, das Gift der kleinen quietschbunten Frösche (ein Symbol der Natur für die quietschbunten fröhlichen Pillen?) wird von vielen nativen Stämmen für die Jagd benutzt. Das Gift mit der Pfeil- oder Speerspitze tief in den Körper des Tieres getrieben, entspannt es die willkürliche und die unwillkürliche Muskulatur gleichermaßen und damit auch die Atmung. Man ist praktisch zu Tode entspannt. Ein Zustand, der mit der allabendlichen Befindlichkeit vieler in der Arbeitswelt lebenden Menschen vergleichbar ist. Im halb-komatösen Zustand, flüssig oder gasförmig betäubt und screenotisiert (hypnositiert durch die Abfolge einer bestimmten Anzahl von Eindrücken – entsprechend der Frequenz des Fernsehflimmerns – durch TV, Computer, Play Station aber auch Kino oder Radio) fristen sie ihr Dasein, hie und da durchsetzt von zeitlich fest begrenzten, am freien Markt erworbenen Horizont-Annäherungen, so called „Fremdenverkehr“, welch treffende Bezeichnung.
Fremde unter Fremden, die sich plötzlich, befreit von den dicht gesponnenen, selbst auferlegten Beschränkungen des heimatlichen Kokons, in sich selbst mehr zu Hause fühlen. Nach zwei Wochen geht’s dann wieder zurück ins geografische Heim, wo man sich unter Zuhilfenahme zweidimensionaler Vergangenheit – in Farbe oder Schwarzweiß – an die Fremde erinnert, mit diesem feinen Stechen in der Brust. Und dann das kurze Aufflackern der Frage: „Was wäre wenn … man einfach sein Zeug packen und verschwinden würde? Das machen, was man schon immer machen wollte. Bei anderen funktioniert es doch auch. Aber sind die nicht auch ganz anders?“
Ich liege auf dem Rücken im Gras des Parque Maria Luisa in Sevilla und blase nach langen Zügen dicken Smoke durch die hellgrünen gefiederten Äste der jungen Eberesche über mir in das Azurblau dahinter. Ich stelle mir vor, wie es wäre so zu sterben, wirklich und konkret den letzten Atemzug zu machen, ganz bewusst und in Frieden zu gehen. Ich beginne zu begreifen, warum ein friedlicher Abschied für derart viele archaische Kulturen so wichtig war und ist. Mir fällt ein, dass bei den Aborigines der Tod durch Verletzungen oder durch bewusstes Sterben als natürlich angesehen wird, der durch Unfall oder Krankheit hingegen nicht. (Ich sollte vielleicht hinzufügen, dass den Menschen dort Verletzungen auch bei Initiationen und Trauer-Ritualen zugefügt werden, also nicht nur durch Unfälle entstehen. Nach der Invasion der weißen Siedler starben übrigens plötzlich viele männliche Aborigines bei solchen rituellen Verletzungen, was als Vorbote für den folgenden Genozid ausgelegt wird). Ein Unfall oder eine Krankheit haben immer einen „bösen Geist“, der meist schon lange vorher da ist. Manchmal kann sogar das eigene Leben zum „bösen Geist“ werden.
Im TV habe ich eine Doku über Kalifornien gesehen, unter anderem von einem Reggae-Festival. Entspannt dahintreibende Beats, happy People everywhere und scheinbar nur ein Thema: Grass. Riesige Tüten machten die Runde, Leute mit Augen wie Briefschlitze und klassisch nach oben gebogenen Mundwinkeln. Worte wie „Universe“, „Energy“, „Love“ und ähnliches entfleuchte ihren Lippen. Klar, ich kann diese Menschen verstehen. Ich kenne diesen Weg. Ich bin ihn selbst ein Jahr lang mitgegangen. Er ist schön, bunt und immer grün. Eine dichte Dornröschenhecke aus Hanf-Stauden begrenzt die Sicht. Drinnen schläft alles hundert Jahre. Nach draußen gelangen die meisten nur, wenn sich unfreiwillig durch das Fehlen von Ressourcen der Nebel lichtet, und rasch kehren sie zurück.
Er ist „bastante tentativo“, verdammt verführerisch, dieser Weg, aber ich will mehr: ein grenzenloses Paradies, universumumspannend, die absolute Freiheit des Seins und sein Ausdruck im ruhig schwingenden Pendel. Die Welt schön Rauchen ist gewiss eine von mehreren Möglichkeiten, allerdings gehört sie zu der Sorte, die die Welt nicht ändern. Ich suche für mich nicht einen Weg ohne Mittel von außen, sondern viel mehr mit allen Mitteln von außen und innen, Zufriedenheit mit dem, was gerade da ist und somit die völlige Präsenz im Hier und Jetzt. Experimentieren mit den gegebenen Möglichkeiten. Innen ruhen, wenn’s außen wogt und stürmt. Das Auge im Inneren zentrieren, dem Bambus im Rückenmark beim Wachsen zusehen. Flexibilität ist gleich Simplizität hoch zwei.
Nicht nur einige wenige, mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptierte „Trigger“ haben, von deren Verfügbarkeit die eigene Gemütslage abhängig ist, sondern Achtsamkeit und damit ein allumfassendes Bewusstsein des eingeschlagenen Weges. Kein „Sich-Wegstellen“, sondern die Gestaltung des Lebens auf so spannende Weise, dass die Bewusstseinserweiterung in den Pausen quasi als i-Punkt fungiert. Vielleicht könnte man so der größten aller Pausen entspannt und gelassen entgegenatmen. Und vorher noch hin und wieder grünen Rauch durch die Eschenzweige pusten.